
|
|
| Reisebericht Gmunden
(Februar 2005) |
| |
|
|
|
|
| |
Straßenbahn-Anfangspackung
mit Ergänzungsset
Ein Beitrag von Patrick Hollmann (FSK e.V.) |
|
| |
|
|
| |
Wenn man die Straßenbahnanlage
in Schönberg bei Kiel schon als „Straßenbahn-Anfangspackung“
bezeichnet, dann darf man die Straßenbahn von Gmunden
in Oberösterreich getrost „Anfangspackung mit Ergänzungsset“
nennen. Die Strecke ist etwa 2,3 Kilometer lang, eingleisig
mit zwei Ausweichstellen und auf einem großen Teil der
Strecke auf eigenem Gleiskörper trassiert. Inklusive der
Endstellen verfügt sie über acht Haltestellen. Gmunden
ist eine 13.000 Einwohner zählende Bezirkshauptstadt im
landschaftlich überaus reizvollen Salzkammergut. |
|
| |
|
|
| |
 Bild 1: Gmunden am Traunsee
Bild 1: Gmunden am Traunsee
|
|
| |
 |
|
Die Stadt liegt am Traunsee und an
der in denselben mündenden Traun.
Gmunden verfügt über zwei Bahnhöfe: Der
Hauptbahnhof liegt an der elektrifizierten Salzkammergutstrecke
der Österreichischen Bundesbahnen und ist Taktknoten
im AustroTakt, dem Integralen Taktfahrplan. Der Seebahnhof
(siehe Bild 4) ist Endpunkt der meterspurigen
Traunseebahn von Vorchdorf (auch GV-Linie genannt) und
einer normalspurigen ÖBB-Bahn von Lambach, die aber
über keinen Personenverkehr verfügt. Er ist
daher dreischienig erbaut. |
|
Bild 2: Gmunden, Schloss Ort
|
|
Während sich der Seebahnhof dicht beim Stadtkern direkt
am Seeufer befindet, ist der Hauptbahnhof weitab und erheblich
höher gelegen. Dies ist auch der Grund für die Existenz
dieser kleinen Straßenbahn, die immerhin über 300.000
Fahrgäste im Jahr zu verzeichnen hat.
|
|
| |
|
|
| |
 Bild 3: Gmunden Hbf
Bild 3: Gmunden Hbf |
|
| |
|
|
| |
Wie
Gmunden zu seiner Straßenbahn kam - Kurze Geschichte der
Bahn
Als der damalige Bürgermeister Gmundens, Alois Kaltenbrunner,
den elektrischen Strom zu Beleuchtungszwecken in Gmunden einführte,
war die Wirtschaftlichkeit des E-Werks nur durch einen großen
Dauerabnehmer zu gewährleisten. Hier bot sich eine elektrische
Lokalbahn an, die den weitab gelegenen Rudolfsbahnhof, der heute
Hauptbahnhof heißt, mit dem Stadtzentrum verbinden sollte.
1893 beauftragte man das Ingenieurbüro Stern & Hafferl
mit dem Bau dieser Bahn. Schon am 13.8.1894 wurde die 2,543
km lange Lokalbahn in Betrieb genommen. Eigentümer war
die Gmundner Elektrizitätsaktiengesellschaft, die GEAG,
später GEG. Der Betrieb wurde mit anfangs vier elektrischen
Triebwagen abgewickelt, die auch teilweise für den Transport
von Gepäck eingerichtet waren. Später wurden Fahrleitung
und Wagen auf Schleifbügel umgestellt.
Seit 1938 ist die Bahn rechtlich eine Straßenbahn.
Bis 1952 wurden die Fahrzeuge der Anfangsausstattung abgestellt
und durch Gebrauchtfahrzeuge ersetzt, u.a. profitierte man von
der Einstellung der nahegelegenen Straßenbahn Unterach
- See, deren gesamten Triebwagenpark (es waren deren zwei) man
übernehmen konnte.
Und seit der Stillegung der Straßenbahn von Ybbs (Spurweite
760mm, Streckenlänge 2,943km, nur 2 Triebwagen Länge
6,55m, Breite 1,85m, Achsstand 2,0m) am 22.9.1953 ist Gmundens
Straßenbahn nun die kleinste der Welt.
1961 lieferte Lohner den vierachsigen Großraumwagen GM
8 neu nach Gmunden aus, der ganze Stolz der GEG.
Der bis auf GM 8 völlig überalterte Wagenpark musste
dringend ersetzt werden. Aus diesem Grund ergriff man 1974 die
günstige Gelegenheit zum Erwerb dreier vierachsiger Großraumwagen
von der Vestischen Straßenbahn im Ruhrgebiet, die bereits
dicht am Abgrund stand und nach starken Netzamputationen diese
Wagen nicht mehr benötigte. Zwei davon gelangten bis 1983
in den Verkehr.
Aber am 6.6.1975 ging es bergab: Die 200m lange Strecke vom
Franz-Josef-Platz zum Rathausplatz wurde stillgelegt, weil die
stadteinwärts fahrende Tram dem an dieser Stelle besonders
starken Autoverkehr entgegenfuhr. Folge dieser Einstellung war
ein längerer Fußweg ins Stadtzentrum und ein Einbruch
der Fahrgastzahlen. Die Streckenlänge beträgt seitdem
nur noch 2,315km.
Auch die Einführung des Einmannbetriebs am 3.7.1978 konnte
den weiteren Niedergang nur verlangsamen. Zwar wurde im September
1979 der Betriebsablauf durch Einführung eines Betriebsfunks
flexibilisiert, doch 1989 war der GEG die Zahlung des „jährlichen
Betriebsabgangs“, also des Defizits, endgültig zu
teuer, und sie drohte mit Einstellung. Hier gründete sich
der Verein „Pro Gmundner Straßenbahn“, dem es
gelang, die Bahn zu retten, indem er sich touristischer Vermarktung,
der Formierung eines Bürgerprotests und der Erstellung
neuer Verkehrskonzepte widmete und auch bei Reparaturen hilfreich
tätig war. Beispielsweise finanzierte er die Generalreparatur
des Großraumwagens GM 8 im Jahr 1994 mit, indem er Spendenmittel
der seinerzeitigen Herstellerfirmen einwarb. Schließlich
sollte der Gmundner Straßenbahn ein Schicksal wie jenes
derer in St. Pölten 1975 erspart werden, der wegen einer
nicht beglichenen Stromrechnung in Höhe von lediglich 30.000
Schilling (umgerechnet etwa 2.000 Euro) ganz einfach der „Saft“
abgedreht worden war. Der besseren Nutzung zu touristischen
Zwecken trug 1995 die Übernahme eines vor 1900 gebauten
Sommertriebwagens von der Pöstlingbergbahn in Linz Rechnung,
welcher in Gmunden die Nummer GM 100 erhielt.
1995 wurde nicht nur der Beibehalt, sondern auch der (Wieder-)Ausbau
der Straßenbahn beschlossen. Man suchte nach einer Beispielstadt
ähnlicher Größe, in der die Straßenbahn
ebenfalls auf der Kippe gestanden hatte, dort aber mit Anstrengungen
erfolgreich saniert, modernisiert und ausgebaut wurde. Die Gmundner
wurden in Nordhausen fündig (Dort hatte die sanierungsbedürftige
Straßenbahn nach einem später kassierten Regierungsbeschluss
1990 als zu kleiner Betrieb von jeglicher Förderung ausgenommen
werden sollen, was einer baldigen Stillegung gleichgekommen
wäre). Nachdem 2003 mit dem Nordhäuser Combino 107
erfolgreich Probefahrten auf der Strecke der Linie G und der
GV-Linie (dort nach Absenken der Fahrdrahtspannung) durchgeführt
wurden, wurde die zweigleisige Verlängerung der Linie G
über Rathausplatz und Traunbrücke bis zum Traunseebahnhof
und dort die Verbindung mit der GV-Linie beschlossen. Ab 2006
soll ein neuer Betriebshof mit einem Parkdeck auf dem Dach gegenüber
dem Hauptbahnhof errichtet und neue Niederflurwagen beschafft
werden. Die Verlängerung ist für 2010, die Verbindung
mit der Traunseebahn für 2012 angepeilt.
|
|
|
|
|
| |
 Bild 4: Stern&Hafferl-Tw 23 111 im Gmundner Seebahnhof
abfahrbereit nach Vorchdorf,
Bild 4: Stern&Hafferl-Tw 23 111 im Gmundner Seebahnhof
abfahrbereit nach Vorchdorf,
4. Februar 2005 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
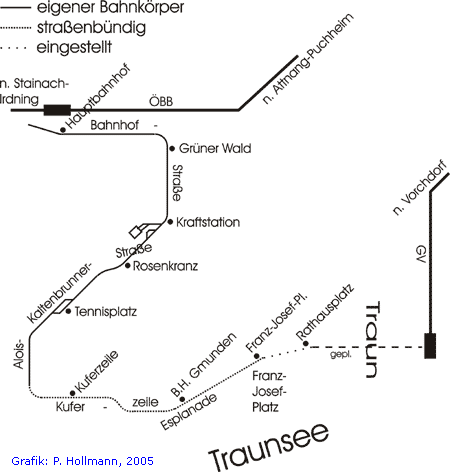 Bild 5: Die Strecke der Gmundner Straßenbahn
Bild 5: Die Strecke der Gmundner Straßenbahn |
|
| |
|
|
| |
Eine
Bilderreise mit der Gmundner Straßenbahn
Direkt vor dem Hauptbahnhof findet der Besucher auf der gegenüberliegenden
Straßenseite die gleichnamige Straßenbahn-Endstelle.
|
|
| |
|
|
| |
 Bild 6: So begrüßt die Gmundner Straßenbahn
derzeit noch die aus dem Hbf tretenden ÖBB-Fahrgäste:
Tw 8 am 5. Februar 2005
Bild 6: So begrüßt die Gmundner Straßenbahn
derzeit noch die aus dem Hbf tretenden ÖBB-Fahrgäste:
Tw 8 am 5. Februar 2005
Hier wird künftig der neue Betriebshof der Straßenbahn
sein, der in den Hang hineingebaut wird, und dessen Dach als
Parkdeck dienen soll. |
|
| |
Gleis und Fahrleitung führen
von hier aus noch etwa 100 Meter weiter und dienen als Abstellgleis.
Wenige Minuten nach der Ankunft des ÖBB-Zuges beginnt auch
die Straßenbahn der Linie G ihre Fahrt in Richtung Stadtzentrum,
die zuerst neben der Bahnhofstraße parallel der Eisenbahngleise
entlangführt und dann mit der Straße scharf nach
rechts abbiegt. Direkt hinter der Kurve liegt die Haltestelle
„Grüner Wald“, die aber nur aus einem Haltestellenschild
an einem Fahrleitungsmast besteht. Da zwischen Straßenbahn
und Straße hier der Bürgersteig liegt, ist nicht
einmal ein Bahnsteig nötig. Nachdem die Salzkammergut-Bundesstraße
unterfahren ist, führt die Strecke durch industriell geprägtes
Gelände bis zum Wahrzeichen der Oberöstereichischen
Kraftwerke AG, dem OKA-Turm, ein hoher Uhrturm mit viereckigem
Grundriss. Direkt am Fuß des OKA-Turms biegt die Bahn
rechts ab und erreicht sofort die Haltestelle „Gmundner
Keramik“, die aber auch zusätzlich mit „Kraftstation“
beschildert ist. |
|
| |
|
|
| |
 Bild 7: Tw 9 erreicht die Haltestelle „Gmundner Keramik
/ Kraftstation“,
Bild 7: Tw 9 erreicht die Haltestelle „Gmundner Keramik
/ Kraftstation“,
5. Februar 2005 |
|
| |
Wie letzterer Name schon sagt,
befindet sich hier der Betriebshof der Gmundner Straßenbahn
mit seiner zweigleisigen kleinen gelben Halle aus der Anfangszeit.
Neben der Halle befindet sich eine von zwei Ausweichen der Bahn. |
|
| |
|
|
| |
 Bild 8: Die Ausweiche am Betriebshof. Tw 8 steht vor der
Wagenhalle,
Bild 8: Die Ausweiche am Betriebshof. Tw 8 steht vor der
Wagenhalle,
5. Februar 2005 |
|
| |
Diese ist so kurz, dass das
Ausweichgleis komplett als Bogen ausgeführt ist. Ebenfalls
befindet sich das einzige Unterwerk hier. Bis zum Ende der Depothalle
ist die Bahn quasi durch die Hintergärten gefahren, ab
hier quert sie spitzwinklig die Alois-Kaltenbrunner-Straße,
der sie auf eigenem Bahnkörper folgt. |
|
| |
|
|
| |
 Bild 9: Tw 9 überquert die Alois-Kaltenbrunner-Straße,
hinten rechts wieder Tw 8 am Depot,
Bild 9: Tw 9 überquert die Alois-Kaltenbrunner-Straße,
hinten rechts wieder Tw 8 am Depot,
5. Februar 2005 |
|
| |
Diese Straße ist nach
dem Bürgermeister benannt, der Elektrizitätswerk und
Straßenbahn erbauen ließ. In diesem Streckenabschnitt
stehen noch hübsche, alte Fahrleitungsmaste aus der Gründerzeit. |
|
| |
|
|
| |
 Bild 10: Tw 8 erreicht die Haltestelle „Rosenkranz“,
5. Februar 2005
Bild 10: Tw 8 erreicht die Haltestelle „Rosenkranz“,
5. Februar 2005 |
|
| |
Dann folgt nach der Haltestelle
„Rosenkranz“ die erste starke Gefällstrecke.
Die Straße liegt auf diesem Abschnitt etwas höher
als die Bahn und ist durch eine Stützmauer von ihr abgegrenzt.
Die nun folgende Haltestelle mit Ausweiche „Tennisplatz“
unterbricht kurz das Gefälle. Hier finden die Zugkreuzungen
zur HVZ planmäßig statt. |
|
| |
|
|
| |
 Bild 11: Zugkreuzung in der Haltestelle „Tennisplatz“:
Tw 9 unterbricht seine Fahrt auf dem Weg bergab ins Stadtzentrum,
während Tw 8 mangels wartender Fahrgäste in Richtung
Hbf. langsam durchfährt, 4. Februar 2005
Bild 11: Zugkreuzung in der Haltestelle „Tennisplatz“:
Tw 9 unterbricht seine Fahrt auf dem Weg bergab ins Stadtzentrum,
während Tw 8 mangels wartender Fahrgäste in Richtung
Hbf. langsam durchfährt, 4. Februar 2005 |
|
| |
Im nun folgenden Abschnitt erreicht
das Gefälle mit 10% sein Maximum. |
|
| |
|
|
| |
 Bild 12: Tw 8 fährt vor der Kulisse herrlicher alter
Villen die Steilstrecke hinab, 4. Februar 2005
Bild 12: Tw 8 fährt vor der Kulisse herrlicher alter
Villen die Steilstrecke hinab, 4. Februar 2005 |
|
| |
Am Ende der Alois-Kaltenbrunner-Straße
biegt die Bahn scharf links in die enge Kuferzeile ein, in der
das starke Gefälle endet. Direkt an dieser Kurve liegt
das Verwaltungsgebäude von Stern und Hafferl, dem Betreiber
von Straßenbahn und Traunseebahn und daneben noch etlichen
weiteren Lokalbahnen, Bauunternehmen und Schiffahrtslinien. |
|
| |
|
|
| |
 Bild 13: Tw 8 vor dem Abbiegen aus der Kuferzeile in die
Alois-Kaltenbrunner-Straße, am Beginn der Steilstrecke.
Links vom Triebwagen ist das Stern & Hafferl-Haus zu sehen.
Rechts der beiden Pkw übrigens das Blinksignal. 4. Februar
2005
Bild 13: Tw 8 vor dem Abbiegen aus der Kuferzeile in die
Alois-Kaltenbrunner-Straße, am Beginn der Steilstrecke.
Links vom Triebwagen ist das Stern & Hafferl-Haus zu sehen.
Rechts der beiden Pkw übrigens das Blinksignal. 4. Februar
2005 |
|
| |
Die Kuferzeile ist nicht nur
sehr eng, sondern auch kurvenreich. Bei der 2004 erfolgten Gleiserneuerung
wurde das Gleis etwas von den Hauswänden abgerückt,
da in Zukunft breitere Wagen verkehren sollen. |
|
| |
|
|
| |
 Bild 14: Tw 10 in der Kuferzeile, März 1993
Bild 14: Tw 10 in der Kuferzeile, März 1993 |
|
| |
An einer Stelle, an der ausnahmsweise
noch Platz für ein Stück Bürgersteig war, hat
man an der Hauswand ein kleines Blechdach und daran ein Haltestellenschild
angeschraubt: Die Haltestelle „Kuferzeile“ ist erreicht.
Die Kuferzeile ist stadteinwärts für den Kraftfahrzeugverkehr
eine Einbahnstraße. Bei der Gleiserneuerung hat man hier
daher für die stadtauswärts dem übrigen Straßenverkehr
entgegenfahrenden Bahnen ein gelbes Blinklicht aufgebaut, das
die Bahn selbst schaltet. Dies ist bisher die einzige „Ampelanlage“
mit der die Gmundner Straßenbahn in irgendeiner Art zu
tun hat. Oft wird aber diese Signalanlage von Autofahrern missachtet,
so dass man mitunter ein Auto hinter einer Biegung genau in
der Richtung verschwinden sieht, aus der es nur Sekunden später
laut klingelt...
Am Ende der Kuferzeile biegt die Bahn spitzwinklig auf die Esplanade
ein, der sie auf der dem Traunsee abgewandten Seite folgt.
|
|
| |
|
|
| |
 Bild 15: Tw 8 beim Abbiegen von der Esplanade in die Kuferzeile,
dahinter das Gebäude der Bezirkshauptmannschaft Gmunden.
4. Februar 2005
Bild 15: Tw 8 beim Abbiegen von der Esplanade in die Kuferzeile,
dahinter das Gebäude der Bezirkshauptmannschaft Gmunden.
4. Februar 2005 |
|
| |
Hier liegt die Haltestelle „B.H.
Gmunden“. Dies ist aber nicht das Rotlichtviertel, sondern
vielmehr ein Hinweis auf die Bezirkshauptmannschaft, vor deren
modernem Gebäude die Haltestelle liegt. |
|
| |
|
|
| |
 Bild 16: Ein Bus der Linie 2 folgt der Straßenbahn
auf der Esplanade, 4. Februar 2005
Bild 16: Ein Bus der Linie 2 folgt der Straßenbahn
auf der Esplanade, 4. Februar 2005 |
|
| |
Nach einer weiteren leichten
Biegung endet die Fahrt heute am Franz-Josef-Platz, einer Grünanlage
am Seeufer. |
|
| |
|
|
| |
 Bild 17: Tw 8 in der Endstelle Franz-Josef-Platz, 4. Februar
2005
Bild 17: Tw 8 in der Endstelle Franz-Josef-Platz, 4. Februar
2005 |
|
| |
Bis 1975 ging es noch 200 Meter
weiter zum Rathausplatz. Die Gleise sind verschwunden, aber
der Fahrdraht ist bis heute noch da.
An der Endstelle „Franz-Josef-Platz“ konnte eine interessante
Einrichtung vorgefunden werden: Eine große viereckige
Uhr. Interessant daran war, dass sie stets falsch ging, die
Zeiger nie von selbst bewegte und doch immer, wenn ich vorbeiging,
eine andere Zeit anzeigte: Des Rätsels Lösung besteht
in einer Handlung des Straßenbahnfahrers, der kurz vor
Abfahrt mit einem Steckschlüssel die Uhrzeit der nächsten
Straßenbahnabfahrt einstellt.
Auf der gesamten Streckenlänge hat die Bahn jetzt übrigens
einen Höhenunterschied von 60 Metern überwunden.
|
|
| |
|
|
| |
Die
Fahrzeuge
Auch wenn es sich beim vorgestellten Betrieb um den kleinsten
der Welt handelt, ist doch die Geschichte des Wagenparks nicht
so einfach und kurz geschildert, wie ich zunächst vermutete.
Die Ursache besteht in der Zugehörigkeit zum Unternehmen
Stern & Hafferl, das erfolgreich ein ganzes Sammelsurium
von Lokalbahnen betreibt und Fahrzeuge unter seinen Bahnen
rege austauscht(e).
Bemerkenswert ist zunächst, dass die Gmundner Straßenbahn
heute über fast genauso viele Museumswagen (2 Stück)
wie Planfahrzeuge (3 Stück) verfügt. Intern wird
der Wagennummer das Kürzel GM vorangestellt.
Der Betrieb wurde 1984 mit vier elektrischen Triebwagen GM
1 - 4 eröffnet, die auch teilweise für den Transport
von Gepäck eingerichtet waren. Die Wagen waren vierfenstrig,
die Plattformen offen. Hersteller dieser Erstausstattung war
die Firma Rohrbacher. Damals fuhr man in Gmunden noch mit
dem Rollenstromabnehmer. Später wurden Fahrleitung und
Wagen auf Schleifbügel umgestellt.
1911 lieferte die Grazer Waggonfabrik den Triebwagen GM 5,
der heute noch für Sonderfahrten bereitsteht.
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
|
Bild 18: Tw 5 in der Bahnhofstraße beim Hbf,
5. Februar 2005
|
Bild 19: Tw 5 in der Alois-Kaltenbrunner-Str.,
5. Februar 2005
|
|
|
| |
1941 übernahm man von der
Straßenbahn Preßburg - Kittsee deren Triebwagen
1534, der in Gmunden die Nummer GM 4II erhielt. Dieser
Wagen wurde 1913 von Ganz in Budapest hergestellt. Somit hatte
sich in Gmunden auch ein waschechter Ungar eingefunden.
1944 wurde Triebwagen GM 2 als Reservetriebwagen an die nahegelegene
und ebenfalls zu Stern & Hafferl gehördende E.L.B.U.S.,
die Elektrische LokalBahn Unterach - See am Mondsee, die seit
1938 ebenfalls eine Straßenbahn war, abgegeben und von
dort der jüngere Triebwagen SM1
2, 1907 in Graz gebaut, übernommen. SM 2 erhielt in Gmunden
die Nummer GM 6 .
Nach Einstellung der Straßenbahn Unterach - See 1949
kam 1952 auch der zweite Triebwagen SM 1 der E.L.B.U.S. nach
Gmunden, den man hier in GM 7 umbenannte.
Damit war der gesamte Triebwagenpark der Straßenbahn
Unterach - See nach Gmunden übergesiedelt! Beide Wagen
existieren bis heute, und zwar fahr- bzw. betriebsfähig:
GM 6 fährt heute in E.L.B.U.S.-Lackierung als historischer
Beiwagen auf der Attergaubahn, GM 7 bei der Museumsstraßenbahn
St. Florian bei Linz.
Mit Inbetriebnahme von Tw GM 7 war der Wagenpark der Anfangszeit
abgelöst, GM 3 wurde als letzter abgestellt und als Beiwagen
an die Attergaubahn abgegeben.
1961 lieferte Lohner den vierachsigen Großraumwagen
GM 8. Dieser ist ein absolutes Einzelstück: Er wurde
1961 in DüWag-Lizenz von Lohner gebaut und verfügt
als einziger Gmundner über den bekannten DüWag-Antrieb.
Obwohl er ein Vierachser ist, besitzt er an beiden Enden die
bekannte DüWag-Gelenkwagenfront mit den eingezogenen,
blendfreien Stirnfenstern. Auf der „Bahnsteigseite“
verfügt er über drei einzelne DüWag-Falttüren,
die über die Wagenseite verteilt sind. Dieser Wagen trug
nun die Hauptlast des Verkehrs.
Aber die als Verstärkungs- und Reservewagen dienenden
Altwagen verlangten in den siebziger Jahren eine Ablösung.
Aus diesem Grund ergriff man die günstige Gelegenheit
zum Erwerb dreier vierachsiger DüWag-Großraumwagen
des Baujahres 1952 von der Vestischen Straßenbahn im
Ruhrgebiet, bei der diese Wagen überzählig waren.
Wagen 340, 341 und 347 wurden 1974 angekauft. Während
Wagen 340 als Ersatzteilspender diente, wurde 1977 Tw 347
als GM 9 und 1983 Tw 341 als GM 10 nach Umbauarbeiten in Betrieb
genommen. GM 9 bringt es dabei nach Auskunft des Fahrpersonals
als Reservewagen lediglich auf wenige Einsatztage pro Jahr.
Die Türen der Gebrauchtwagen wurden auf einer Fahrzeugseite
durch je zwei Fenster ersetzt, innen mit einer Sitzbank zugebaut.
Auf der anderen Wagenseite wird von beiden Doppeltüren
nur der jeweils zur Wagenmitte hin gelegene Türflügel
geöffnet, der Trittkasten der übrigen Türen
ist mit einem Blech abgedeckt.
Alle drei Großraumwagen wurden von Kiepe elektrisch
ausgerüstet, wobei die Ausrüstung der Wagen 9 und
10 stark abweicht: Besitzt der Wagen GM 8 einen konventionellen
Kurbelfahrschalter, so besitzen die „Vestischen“
einen druckluftgesteuerten Unterflurzentralfahrschalter mit
Hebelsteuerung, ein druckluftbetätigtes Hauptschütz,
druckluftbetätigte Federspeicher und Türen. Im Vergleich
zum Wagen 8 sind sie denn auch beim Personal als wartungsaufwändig
und ein wenig störanfällig bekannt.
Alle drei Wagen sind noch für bedarfsweise Schaffnerbedienung
durch Pendelschaffner eingerichtet, obwohl sie stets als Einmannwagen
eingesetzt werden: Große blaue Einsteckschilder "Schaffnerloser
Betrieb. Bitte vorn einsteigen" in den Fenstern weisen
darauf hin.
Aber auch dieser Wagenpark kommt jetzt zunehmend in die Jahre.
Mit dem Nordhäuser Combino Tw 107 konnte der Beweis für
die Einsatztauglichkeit von Niederflurwagen erbracht werden.
Dieser Probeeinsatz im Juni/Juli 2003 erstreckte sich nicht
nur auf die Gmundner Straßenbahn, sondern auch, nach
vorübergehender Verringerung der Fahrdrahtspannung, auf
die Traunseebahn nach Vorchdorf.
Als Gegenleistung für den abgegebenen Niederflurwagen
wurde GM 100 2004 zur Landesgartenschau in Nordhausen eingesetzt.
Obwohl das Weiterbestehen der Gmundner Straßenbahn seit
den 70er Jahren bis in die 90er Jahre immer wieder infrage
gestellt wurde, erfreut sich der Wagenpark hervorragender
Pflege.
Der Verein "Pro Gmundner Straßenbahn" finanzierte
die Generalaufarbeitung des Großraumwagens GM 8 im Jahr
1994 mit, indem er Spendenmittel der seinerzeitigen Herstellerfirmen
Bombardier (heutiger Eigentümer von Lohner) und Kiepe
einwarb. Dabei wurde auf eine originalgetreue Restaurierung
dieses historisch wertvollen Unikats geachtet.
1994 feierte man „Gmundens steilstes Fest“, den
hundertjährigen Geburtstag der Straßenbahn u.a.
mit einem offenen historischen Sommerbeiwagen (!) aus Klagenfurt.
Die Fahrten mit diesem Beiwagen waren ein riesiger Erfolg,
und so schmiedete man Pläne, einen solchen Triebwagen
zu beschaffen. Die Linzer Verkehrsbetriebe waren bereit, einen
ihrer 1898 gebauten Sommertriebwagen der Pöstlingbergbahn
als Dauerleihgabe der Stadt Gmunden zu überlassen. Bei
ihm mussten die doppelten Spurkränze abgedreht und die
Zangenschienenbremse durch eine Magnetschienenbremse ersetzt
werden; außerdem wurde eine modernen Straßenbahnvorschriften
gemäße Beleuchtung und ein statischer Umformer
eingebaut. Dabei verwendete die Stern & Hafferl - Hauptwerkstätte
Vorchdorf historische Scheinwerfer, Winkerlampen und Liniensignale,
die man im Lager noch gefunden hatte. Der Stangenstromabnehmer
wurde gegen einen drehbaren Lyrastromabnehmer ausgetauscht.
Schließlich erfolgte noch eine Neulackierung in Karminrot/Weiß.
Als GM 100 ging der Wagen 1995 in Betrieb.
Außerdem gibt es einen Vorbauschneepflug, eine fahrbare
Leiter und einen Reserve-Stromabnehmer, der außen an
der Remise aufgehängt ist.
|
|
| |
|
|
| |
Wagenparkstatistik |
|
| |
| Wagennummer |
Baujahr |
Hersteller |
Bem. |
| GM 1 - 4 |
1894 |
Rohrbacher |
2x-Tw, anfangs offene Plattformen,
Stangenstromabnehmer, später Schleifbügel;
GM 1: 1949 abgest., 1954 = a
GM 2: 1944 = E.L.B.U.S.2
Reserve-Tw SM1 2II
(Tausch gegen SM 2, s.u.), 1949 abgest., 1952 = VA3
Beiwagen 20.204, 1960 = 26.204,1962 = a;
GM 3: 1952 abgest., 1955 = VA Beiwagen 20.205, 1960 =
26.205, 1975 Fahrgestell = VKEF4
GM 4: 1935 abgest. 1950 = a
|
| GM 5 |
1911 |
Grazer Waggonfabrik/ SSW |
2x-Tw, halbgeschlossene Plattformen, betriebsfähig |
| GM 4II |
1913 |
Ganz Budapest |
2x-Tw, 1941 ex Preßburg-Kittsee Tw
1534, a nach 1977 |
| GM 6 |
1907 |
Grazer Waggonfabrik |
2x-Tw, 1944 ex E.L.B.U.S. SM 2, 1961 abgest.,
1962 = Beiwagen VA 20.220, heute in hist. E.L.B.U.S.-Lackierung,
betriebsfähig |
| GM 7 |
1907 |
Grazer Waggonfabrik |
2x-Tw, 1952 ex E.L.B.U.S. SM 1, nach 1977
= Museumsbahn St. Florian Tw 7, betriebsfähig |
| GM 8 |
1961 |
Lohner / Kiepe |
4x-Tw, betriebsfähig |
| GM 9 |
1952 |
DüWag / Kiepe |
4x-Tw, 1974 ex Vestische Straßenbahn
347, Einsatz seit 1977, betriebsfähig |
| GM 10 |
1952 |
DüWag / Kiepe |
4x-Tw, 1974 ex Vestische Straßenbahn
341, Einsatz seit 1983, betriebsfähig |
| GM 100 |
1898 |
Grazer Waggonfabrik |
2x-Tw, offener Sommerwagen, 1995 ex Linz
Pöstlingbergbahn IV, betriebsfähig |
| 340 |
1952 |
DüWag / Kiepe |
4x-Tw, 1974 ex Vestische Straßenbahn
340, Ersatzteilspender, kein Einsatz, a |
|
|
| |
|
|
| |
Leihfahrzeuge mit kurzzeitigem
Einsatz in Gmunden:
- Tw 107: Niederflur-Gelenkwagen "Combino", Bj.
2002, Eigentum Stadtwerke Nordhausen, 30.06.2003 bis 06.07.2003
leihweise im Einsatz zu Erprobungszwecken, auch im Linienverkehr.
- Sommerbeiwagen der Museumstramway Klagenfurt, 1994 zum
100-Jährigen.
|
|
| |
|
|
| |
Betriebsablauf
Der Fahrbetrieb beginnt werktags außer Samstag um 5.00,
an Samstagen um 5.55 und an Sonn- und Feiertagen um 7.00 Uhr,
wenn der erste Wagen vom Depot in Richtung Franz-Josef-Platz
ausrückt. Von wenigen Abweichungen abgesehen, fährt
die Bahn mit einem Triebwagen den ganzen Tag über im 30-Minuten-Takt.
In den HVZ wird der Takt auf 15 Minuten verdichtet. Dann ist
ein zweiter Wagen im Einsatz. Wenn dies der Fall ist, dürfen
beide Wagen maximal mit der höchsten Serienfahrstufe fahren,
um die Stromversorgungsanlage nicht zu überfordern.
Planmäßig kreuzen sich die Kurse in der Ausweiche
Tennisplatz, bei Verspätungen aber natürlich auch
am Betriebshof. Die Kreuzungsabstimmung erfolg per Funk. Die
vier Weichen an den Kreuzungsstellen sind Rückfallweichen
mit elektrischer Weichenheizung, zudem sind noch zwei normale
Handweichen im Betriebshof vorhanden.
Die Fahrzeit für die Gesamtstrecke beträgt lediglich
neun Minuten, so dass sich an den Endstellen meist fünf
bis sechs Minuten Pause ergeben. Auch eine Art „Schnellinie“
gibt es in Gmunden: An Schultagen außer Samstagen verkehrt
um 7.35 Uhr eine zusätzliche Fahrt vom Hauptbahnhof zum
Betriebshof ohne Halt! Gleiches geschieht an Werktagen außer
Samstagen um 18.27 Uhr. An den Haltestellen Rosenkranz und Franz-Josef-Platz
besteht Anschluss zu Ortsbuslinien. Betriebsschluss ist um 20.50
Uhr, wenn der letzte Wagen vom Franz-Josef-Platz einrückt,
am 24. und 31. Dezember bereits um 19.55 Uhr, denn dann rückt
der Wagen vom Hauptbahnhof als Dienstwagen ein.
Etwas verspätete ÖBB-Züge von Attnang-Puchheim
werden in der Regel abgewartet. Wird dadurch die Verspätung
der Straßenbahn zu groß, so fällt ganz einfach
irgendwann eine Hin- und Rückfahrt aus, und es geht planmäßig
weiter!
Der gesamte Personalbestand setzt sich aus fünf Fahrern
zusammen. Die Fahrer, die gerade nicht im Fahrdienst eingesetzt
sind, führen die Wartungs- und Reparaturarbeiten an den
Fahrzeugen durch.
Große Umbauten und Reparaturen werden in der Stern &
Hafferl- Hauptwerkstätte Vorchdorf ausgeführt.
|
|
| |
|
|
| |
Literatur
Lehnhart, Hans: „Straßenbahn Unterach - See“,
in: Strassenbahn Magazin, Heft 7, Stuttgart
1973
Lehnhart, Hans: „Stern & Hafferl - Bahnen: Lokalbahn
Vöcklamarkt - Attersee“, in:
Strassenbahn Magazin, Heft 11, Stuttgart 1973
Lehnhart, Hans: „Stern & Hafferl - Bahnen: Ergänzungen
und Berichtigungen“, in:
Strassenbahn Magazin, Heft 26, Stuttgart 1977
|
|
| |
|
|
| |
Noch ein Bilderbogen |
|
| |
|
|
| |
 |
|
|
|
Tw 8, Esplanade,
4.2.2005
|
Führerstand Tw 8, Hbf,
4.2.2005
|
Tw 8, Esplanade,
4.2.2005
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
|
|
Tw 8, A.-Kaltenbrunner-Str.,
5.2.2005
|
Innenraum Tw 8, Hbf,
4.2.2005
|
Tw 8, Tennisplatz,
4.2.2005
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
|
|
Die drei Plantriebwagen der Gmundner Straßenbahn
am selben Tag: Tw 8, 9 und 10. Hier sieht man, dass
die Wagen für die Depothalle wirklich nicht länger
hätten sein dürfen.
5.2.2005
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
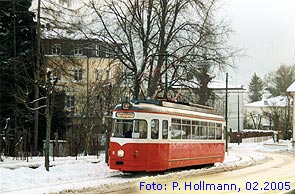 |
|
|
Tw 9 am Beginn der Steilstrecke, 4.2.2005
|
Tw 8 und 5, Franz-Josef-Platz, 5.2.2005
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
|
Tw 5, Franz-Josef-Platz, 5.2.2005
|
Tw 5 in der Steilstrecke, 5.2.2005
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Zum Abschied noch zwei Nachtaufnahmen vom Tw 8, Franz-Josef-Platz,
5.2.2005
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
1
SM steht für die Gemeinde See am Mondsee
2 E.L.B.U.S.: Elektrische LokalBahn Unterach - See,
Stern & Hafferl, stillgelegt 18.9.1949
3 VA: Elektrische Lokalbahn Vöcklamarkt - Attersee
„Attergaubahn“, Stern & Hafferl
4 VKEF: Verein Klagenfurter EisenbahnFreunde
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|

